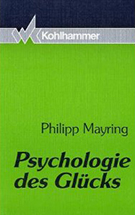Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Glückstherapien entwickelt, die das Ziel verfolgen, die Häufigkeit und Intensität von Glücksempfindungen zu erhöhen. Kritiker warnen davor, dass ein reines "Drehen an der Glücksschraube" ohne Berücksichtigung größerer Lebenszusammenhänge nutzlos oder sogar schädlich sein können, dass die Ansätze auf der subjektiven Ebene bleiben und nicht die objektiven Lebensbedingungen ändern sowie eher auf das aktuelle Glückserleben gerichtet sind ("state") und nicht auf das biographische Lebensglück ("trait"). Auf der anderen Seite zeigen sich nach Anwendung einer Glückstherapie oft erstaunliche Ergebnisse.
Beispielhaft werden die Glückstherapie nach Fordyce sowie das Glückstraining von Lichter, Hay & Kammann vorgestellt. Alle Beschreibungen entstammen dem Buch "Psychologie des Glücks" von Philipp Mayring.
Glückstherapie nach Fordyce
Michael W. Fordyce entwickelte eine stark theoriegeleitete und verhaltenstheoretisch orientierte Glückstherapie, in der er emotionale, situative, physiologische, aktionale, kognitive und biographische Faktoren des Glücks berücksichtigte. Basis der Therapie, die ein Einsichts- und Übungsprogramm enthält, sind die folgenden Grundsätze:
- Werde aktiver und halte Dich beschäftigt
- Bringe mehr Zeit mit anderen Menschen zu
- Sei produktiv durch sinnvolle Arbeit
- Sei systematischer und plane die Dinge besser
- Höre auf, Dir Sorgen zu machen
- Setze niedrigere Ansprüche und Erwartungen
- Entwickle ein positives, optimistisches Denken
- Orientiere Dich an der Gegenwart
- Arbeite an einer gesunden Persönlichkeit (Selbstakzeptanz)
- Entwickle eine nach außen gerichtete, soziale Persönlichkeit
- Sei Du selbst
- Eliminiere negative Gefühle und Probleme
- Die engsten Beziehungen sind die wichtigsten
- Erkenne, dass Glück wertvoll ist
In der Glückstherapie wird zunächst versucht, die Grundsätze zu verstehen und auf das eigene Leben zu beziehen. Dann werden konkrete Übungen zu den einzelnen Grundsätzen durchgeführt. Bezogen auf jeden der o.g. Grundsätze könnten sich beispielsweise folgende Aktivitäten ergeben:
- Einführen von ein bis zwei zusätzlichen freudebringenden Aktivitäten in den Tageslauf
- Einladung organisieren; alte Freundschaften aktivieren
- Überdenken von Berufswahl und Karriere
- Konkrete Pläne für die nächsten Wochen, Monate und Jahre
- Sorgentagebuch zum Nachweis der Unbegründetheit
- Analyse der persönlichen Ziele; Versuch der Minimierung
- Konzentrationsübungen auf positive Aspekte der Lebensereignisse
- Versuch, die laufende Woche zur besten Woche des Lebens zu machen, unabhängig von Vergangenheit und Zukunft
- Konzentration auf die positiven Seiten und Akzeptanz der negativen Seiten der eigenen Persönlichkeit; Selbstvertrauen, Selbständigkeit;
- Mitgliedschaft in interessanten Vereinen; Leute anlächeln und grüßen; neue Leute kennen lernen
- Spontaneitätsübungen; Ausdruck der eigenen Gefühle
- Bei nicht bewältigbaren Problemen professionelle Hilfe aufsuchen; die restlichen negativen Gefühle abschalten;
- Mit engsten Bezugspersonen mehr Zeit verbringen; Beziehungsprobleme lösen
- Mehr nachdenken über Glück; Glück als übergeordnetes Ziel erkennen
In fünf Studien mit 500 Versuchspersonen zeigte sich, dass auch 18 Monate nach Abschluss des Programms die Teilnehmer statistisch signifikant höhere Glückswerte aufwiesen.
Glückstraining von Lichter, Hay & Kammann
Lichter, Hay & Kammann aus Neuseeland entwickelten ein kognitives Glückstraining, das versucht, glücksbehindernde Grundüberzeugungen durch glückfordernde Überzeugungen zu ersetzen.
Glücksbehindernde Überzeugungen sind beispielsweise:
- Meine Gefühle werden durch die Zustimmung/Ablehnung anderer kontrolliert.
- Ich halte meine Persönlichkeit für unveränderlich.
- Ich fühle mich schuldig für Dinge, die ich gesagt oder getan habe.
- Ich habe Sorgen über die Zukunft oder Ereignisse in der Zukunft.
- Ich werde ärgerlich über Leute oder Dinge.
- Ich nörgle an anderen Menschen herum.
- Ich verlange Gerechtigkeit und Fairness.
Glücksfördernde Überzeugungen sind dagegen beispielsweise:
- Ich stehe zu meinen Emotionen und Gefühlen
- Ich fühle mich gut in meiner Haut
- Ich bin bereit für neue Erfahrungen.
- Ich kann Misserfolge verkraften ohne mich selber zu verurteilen.
- Ich fürchte mich nicht davor, unkonventionell zu sein
- Ich kann frei handeln aufgrund meiner eigenen Gefühle und Überzeugungen.
- Ich bin emotional offen und nahe bei einem Menschen.
- Ich freue mich über die Gegenwart.
Mehrere Therapiekontrollstudien haben die Wirksamkeit auf das Glückserleben bestätigt.
Weiterlesen
- » Positive Psychologie
- » Meditation
- » Achtsamkeit
- » Lachen
- » Positives Denken
- » Beziehung
- » Kinder
- » Freundschaft
- » Arbeit
- » Lebensziele
- » Glückstherapien
- » Glücksverhinderer
- » Glücksrezepte
- » Nächste Seite: Glücksverhinderer